#autismusspektrumstörung #aspergersyndrom #neurodivergenz #neurodiversität #inklusion
Svenja Diederichs
So hilfst du Autisten, gesund zu bleiben!
Autistische Menschen sind Teil unserer Gesellschaft. Dennoch ist das Wissen über Autismus und den passenden Umgang mit Autisten oft lückenhaft. Hier erfährst du, was Autismus ausmacht und wieso Rücksichtnahme auf die Besonderheiten von Autisten ausgesprochen wichtig ist.
Was ist Autismus, wann und wodurch entsteht er?
Autismus ist genetisch bedingt und angeboren. Es handelt sich um eine Form von Neurodivergenz. Menschen ohne neuronale Abweichungen nennt man hingegen neurotypisch.
Bei Autisten bestehen Besonderheiten in der Hirnstruktur, besonders in Bezug auf das neuronale Netzwerk und seine Schnittstellen, Synapsen genannt. Es gibt u.a. Unterschiede bei der Reizweiterleitung, bei den Hormonausschüttungen und bei Art und Geschwindigkeit der Reizverarbeitung. Daher ist das Welterleben von Autisten in mancher Hinsicht deutlich anders als das von neurotypischen Menschen.
Allerdings ist das Gehirn bei einem Säugling noch längst nicht „fertig“. Innerhalb der ersten Lebensjahre finden bei jedem Kind massive Auf-, Ab- und Umbauprozesse der Synapsen statt. Somit kann bei einem Nervensystem, das noch am Anfang seiner Entwicklung steht, Autismus noch nicht vollständig manifestiert sein. Dennoch gibt es Fälle, in denen sich Autismus bereits im Säuglingsalter bemerkbar macht, beispielsweise, wenn das Nervensystem so überempfindlich auf Berührung reagiert, dass Körperkontakt zu den Eltern als extrem unangenehm empfunden wird. Bei anderen Autisten hingegen werden Auffälligkeiten erst später bemerkt oder als schlechtes Benehmen oder psychisches Problem fehlinterpretiert.
In seltenen Fällen kommt es bei ein- bis zweijährigen Kindern vor, dass ihre Entwicklung in verschiedenen Bereichen zum Stillstand kommt, oder sogar bereits erworbene Fähigkeiten, wie z.B. das Sprechen, wieder verlorengehen. Die Autismusforschung konnte die Ursachen hierfür noch nicht gänzlich klären, fand jedoch Hinweise auf mögliche Zusammenhänge mit epileptischen Anfällen.
Allerdings sind nicht alle kleinen Kinder mit Fähigkeitsverlusten und an Autismus erinnerndem Verhalten wirklich autistisch: Es kann sich auch um Kinder mit degenerativen Erkrankungen wie dem Heller-Syndrom oder dem Rett-Syndrom handeln.
Davon abgesehen wird Autismus oft deutlich stärker nach außen hin sichtbar, wenn die Umweltbedingungen für Autisten schwieriger, stresserhöhender und kräftezehrender werden. Daher kommt es vor, dass sie erst dann aufgrund von auffälliger gewordenem Verhalten als autistisch erkannt werden und / oder bedingt durch Stress, Angst oder Erschöpfung bestimmte Fähigkeiten zumindest zeitweilig nicht mehr ausüben können. Ebenso ist ein durch Traumata ausgelöster temporärer oder auch permanenter Fähigkeitsverlust bei Autisten und Nichtautisten verschiedener Altersstufen möglich.
Kann man Autismus abtrainieren?
Autisten verhalten sich oft ungewöhnlich, weil sie von ihren kognitiven Prozessen, ihrer Wahrnehmung und ihren Bedürfnissen her anders sind. Durch Einwirkungen des Umfelds und gegebenenfalls auch durch „Autismustherapie“ gewöhnen Autisten sich häufig ein nach außen hin unauffälliger wirkendes Verhalten an. Dadurch sind sie innerlich jedoch nicht weniger autistisch als zuvor.
So kann man beispielsweise einem stark berührungsempfindlichen autistischen Kind beibringen, Händeschütteln und Umarmungen zu erdulden, und kann dabei auch mit Belohnungen arbeiten. Dennoch wird es die Berührung dadurch nicht irgendwann als angenehm empfinden. Autisten leiden oft neuronal bedingt unter einer erhöhten Licht- und Lärmempfindlichkeit, ertragen Geschmack oder Struktur diverser Lebensmittel nicht und haben Schwierigkeiten mit dem „Wegfiltern“ von Nebengeräuschen und anderen Störreizen. Sensorische Hypersensibilität und Reizfilterschwäche werden jedoch nicht durch Gewöhnung besser, sondern im Gegenteil: Je länger Autisten dem Reizchaos ausgesetzt sind, desto schlimmer leiden sie darunter.
Da sie jedoch oft keine Berücksichtigung ihrer Überempfindlichkeit erleben, lernen sie, sich zusammenzureißen und die extrem schlauchende, quälende, ablenkende Reizüberflutung, auch bekannt als sensorischer Overload, stillschweigend zu ertragen. Ihr Stresspegel kann dabei so extrem ansteigen, dass sie durchdrehen, was man auch als autistischen Meltdown bezeichnet, geistig komplett abschalten, auch bekannt als Shutdown, oder in extreme Erschöpfungszustände geraten. Gleichförmige Bewegungsmuster und ritualisierte Verhaltensweisen können Autisten bei der Stresskompensation helfen. Werden diese jedoch abtrainiert, ihre Umsetzung verhindert oder feste Pläne vereitelt, nimmt der Stress massiv zu.
Autisten empfinden direkten Blickkontakt oft als unangenehm und können die Stimmung einer Person nicht aus deren Augen ablesen. Zudem lenkt Blickkontakt sie stark von anderen Dingen ab, z.B. von Gesprächsinhalten und eigenen Gedanken. Dennoch gewöhnen sich viele Autisten an, in die Augen oder zumindest ins Gesicht zu blicken, weil es gesellschaftlich von ihnen erwartet wird. Hierbei müssen sie Intensität und Länge des Blickkontakts bewusst steuern, im Bemühen, ihn natürlich wirken zu lassen, was sie viel Energie kostet.
Ebenso anstrengend und fehleranfällig ist für Autisten die bewusste Steuerung ihrer Mimik, welche naturgegeben missverständlich und wenig aussagekräftig ist, die Interpretation der Mimik ihres Gegenübers, was neurotypischen Menschen untereinander automatisch gelingt, und mitunter auch die Tonfallinterpretation und eigene Stimmmodulation. Am einfachsten ist es für Autisten daher meist, sich vollständig auf die gesprochene Sprache zu fokussieren, sehr präzise zu formulieren und unverblümt genau das zu sagen, was sie meinen.
Leider passen sich neurotypische Menschen diesem Sprachstil jedoch selten an. Stattdessen interpretieren sie in die Worte von Autisten Dinge hinein, die sie nicht gesagt haben, und unterstellen ihnen Intentionen, die gar nicht vorlagen, während sie sich ihrerseits oft uneindeutig ausdrücken und sich dann wundern, wieso ihre Botschaft nicht angekommen ist. Zudem sind sie selten bereit zur Rücksichtnahme gegenüber autismusbedingten Bedürfnissen und üben Anpassungsdruck auf Autisten aus. Wenn Autisten z.B. ihre Pausen gerne für sich alleine nutzen, um sich von Lärm zu erholen und für sie anstrengende Gruppengespräche und Essensgerüche zu vermeiden, wird ihnen dies oft als unsozial ausgelegt.
Was können autistische Menschen für sich tun?
Autistischen Menschen rate ich, sich eingehend mit den Symptomen von Autismus und deren Ursachen zu beschäftigen, um mehr Verständnis für ihre eigenen Bedürfnisse und Besonderheiten zu entwickeln und Wege zu finden, diesen Rechnung zu tragen. Sich ständig verbiegen zu müssen, während ihr Umfeld gar nicht merkt, wie zermürbend der normale Alltag für sie ist und wie sehr sie sich anstrengen müssen, um ein natürlich wirkendes Auftreten zu zeigen, ist nicht gesund und führt langfristig durch die Dauerüberlastung zu einer speziellen Art von Erschöpfungsdepression / Stressdepression, die auch als autistischer oder neurodivergenter Burn-out bekannt ist.
Da die Erholungszeiten von einem solchen Burn-out sehr lang sind, sollte man es besser gar nicht so weit kommen lassen, sondern gleich seinen Bedürfnissen Raum geben und Umfeldanpassungen in die Wege leiten, z.B. durch Aufklärung und Bitte um Rücksichtnahme. Wichtig ist es, jedem begreiflich zu machen, dass Autismus nichts ist, was man durch Therapie weg bekommt, sondern etwas Dauerhaftes, was Verständnis und Entgegenkommen erfordert, ähnlich wie beispielsweise Blindheit oder Gehörlosigkeit. Oft haben autistische Menschen Probleme mit dem Selbstwertgefühl, da sie wiederholt negative Rückmeldungen bekommen, wenn ihre Bemühungen, sich unauffällig zu verhalten, scheitern. Die Diagnose kann ihnen somit helfen, sich nicht mehr als Versager zu fühlen, sondern zu erkennen, dass sie trotz erschwerter Ausgangsbedingungen viel im Leben erreicht haben. Auch sollten sie ihre, oft autismusbedingten, Stärken beleuchten und würdigen.
Wie sollte man mit autistischen Menschen umgehen?
Wichtig ist, an Autisten nicht immer gleiche Maßstäbe zu setzen wie an andere Menschen. Was bei neurotypischen Menschen ein böser Blick ist, ist bei einem Autisten vielleicht einfach nur ein leerer Blick ohne Aussagekraft. Was bei neurotypischen Menschen ein gemeiner, versteckt formulierter Seitenhieb ist, ist bei einem Autisten vielleicht nur eine ehrliche Äußerung ohne böse Hintergedanken. Statt vorschnell zu urteilen, frage nach, höre zu und gib Autisten Raum, um Missverständnisse aufzuklären, statt zu meinen, sie würden nur Ausflüchte vorbringen wollen. Denk daran, dass Autisten Dinge oft wörtlich nehmen und Mimik nur wenig deuten können, und passe dein Sprachverhalten daran an. Wenn ein autistischer Mensch scheinbar auf einer Kleinigkeit beharrt, glaube ihm, dass diese Sache für ihn ungeheuer wichtig ist und nimm Rücksicht, statt dich schikaniert zu fühlen und aus Prinzip zu weigern. Gib Autisten Raum zum Anderssein und sich anders verhalten, ohne ihnen deswegen Vorwürfe zu machen oder sie zu verhöhnen.
Rücksichtnahme und Verständnis zu erleben kann einen gewaltigen Unterschied im Leben eines Autisten machen. Ohne dies entwickeln Autisten oft extreme Sozialangst und massive Depressionen, was mit totalem sozialen Rückzug und Lebensmüdigkeit enden kann, und das wünscht man natürlich Keinem!
healthstyle
Über die Autorin Svenja Diederichs:

Svenja Diederichs ist studierte Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin, hat einen universitären Abschluss in Autismusstudien und ist zertifizierter Neurodiversitätscoach. Sie arbeitet schwerpunktmäßig als Autismusberaterin, Autismuscoach und Anti-Mobbing-Trainerin. Da sie selbst Autistin ist, lässt sie neben ihrem Fachwissen auch ihre Innensicht auf Autismus in ihre Arbeit einfließen.
Webseite: www.autismussupport.de
Beitragsbild: © Polina - pexels.com




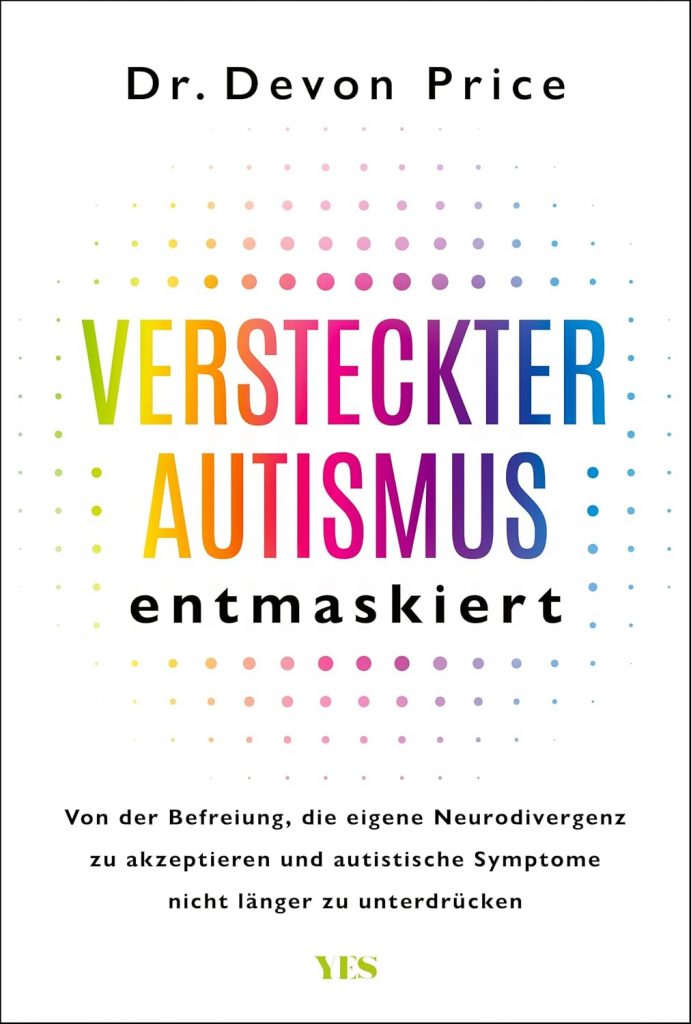









Kommentare sind deaktiviert